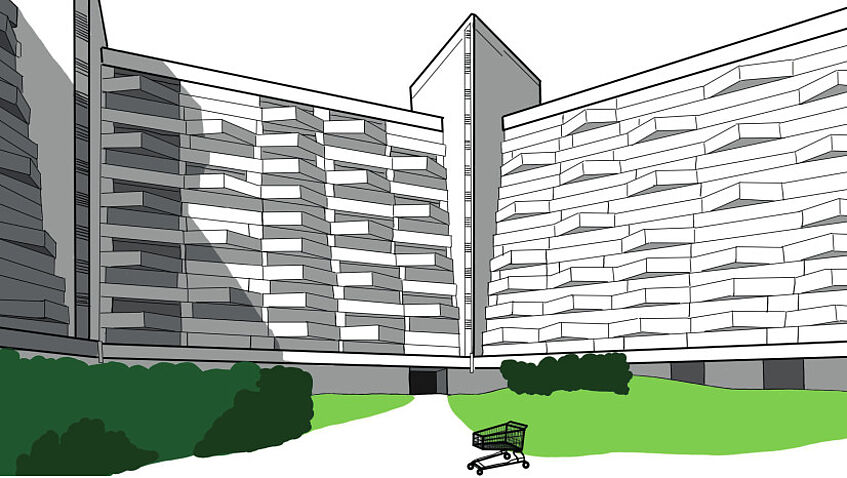
© Institut für Soziologie
Die Blume unter den Gemeindebauten
Überblick
- Ein interdisziplinäres Forschungspraktikum unter der Leitung von Petra Herczeg und Camilo Molina hat sich mit den Lebens- und Wohnbedingungen im Olof-Palme-Hof in Wien-Favoriten beschäftigt.
- Die Studierenden führten in Kooperation mit dem MieterInnenbeirat vor Ort Befragungen durch, die buchstäblich viele Türen öffneten.
- Im Vordergrund des Projekts stand die Frage: „Was bringt das den Beforschten?“
Vielen Menschen rieselt die Gänsehaut über den Rücken, wenn sie von der Ferne die Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten sehen. Doch dieses Schaudern ist vorurteilsgesteuert. Studierende der Universität Wien haben im Rahmen eines Forschungspraktikums die Wohnbedingungen im Olof-Palme-Hof, einem Teil der Per-Albin-Hansson-Siedlung, analysiert – in Kooperation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Sowohl das methodische Vorgehen als auch die Ergebnisse verdienen Beachtung.
„Wir hatten keine Finanzierung, keine Auftraggeber, keine Agenda. Das war für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung.“ So fasst Co-Projektleiter Camilo Molina vom Institut für Soziologie der Universität Wien das Projekt „Lieben, leben, leiden im Olof-Palme-Hof“ zusammen, das er im Rahmen eines interdisziplinären Forschungspraktikums gemeinsam mit Petra Herczeg vom Institut für Publizistik im Wintersemester 2018/19 durchgeführt hat. Beim Videointerview im Sommer 2020 war allerdings nur Camilo Molina anwesend. „Unser Forschungsgegenstand war der soziale Wohnbau der Nachkriegszeit“, erzählt Molina. Dessen Reputation ist, wie man als zugereister Wiener weiß, zweifelhaft – die Vorurteilsdichte ist hoch. Schöpfwerk, Rennbahnweg, Großfeld- und Per-Albin-Hansson-Siedlung: Wer in die Hauptstadt kam, um in zugigen Altbauwohnungen der Gründerzeit seine Bohemien- bzw. Bohemienne-Tauglichkeit zu überprüfen, den packt bei der Erwähnung dieser Orte und der Vorstellung, dort zu wohnen, unweigerlich leichte Beklemmung. In den Plattenbauten, so vermutet man aus einem WG-Zimmer innerhalb des Gürtels und mit entsprechender medialer Vermittlung, poltert der dumpfe Beat der Vorstadt, und die Kriminalitätsberichte reichen von Messerstechereien rivalisierender Jugendgangs bis zu den Favoritner Mädchenmorden.
„Wir wollten herausfinden, wie die Bewohnerinnen und Bewohner im Olof-Palme-Hof ihre Lebensqualität einschätzen, wie hoch die Wohnzufriedenheit ist, wie differenziert die Wohnverhältnisse sich dort darstellen“, erläutert Molina. Die Studierenden im Forschungspraktikum sollten konkrete Einblicke in die Praxis des Erforschens sozialer Fragen gewinnen. „Doch wir wollten von Anfang an die Frage stellen: Was bringt das den Beforschten?“ Also ging es auch darum, sich zu überlegen, wie man mit den Menschen, die in sozialen Wohnbauten leben, gemeinsam forschen kann.
Was bringt das den Beforschten?
Projektleiterin und Projektleiter entschieden sich schließlich für den 1972–1976 als Teil der Per-Albin-Hansson-Siedlung errichteten Olof-Palme-Hof (OPH) als Forschungsobjekt, weil dessen Größe mit rund 400 Wohneinheiten überschaubar ist und es dort seit vielen Jahren einen aktiven MieterInnenbeirat gibt, der auch Vertretungsfunktionen gegenüber Wiener Wohnen, der Hausverwaltung der rund 220.000 Wiener Gemeindewohnungen, ausübt.
Die Studierenden entwickelten gemeinsam mit den Mitgliedern des MieterInnenbeirates einen 16-seitigen Fragebogen, mit dem viele Aspekte des „Lebens, Liebens, Leidens“ im Gemeindebau beleuchtet werden sollten. Im Anschluss daran wollten sie durch Tür-zu-Tür-Befragungen Kontakt zu möglichst allen BewohnerInnen des Hofs herstellen.
Der MieterInnenbeirat hatte hohes Interesse an der Zusammenarbeit, erzählt Molina. „Denn zum Teil kennt man dort die erst vor kurzem zugezogenen Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht, weiß nicht, wer die eigentlich sind, ob und warum sie anders sind und was sie wollen.“ Die Befragung sollte hier Abhilfe schaffen. „So eine wissenschaftliche Untersuchung kann aber natürlich auch die Verhandlungsposition des Mieterbeirates gegenüber der Stadt- und Bezirkspolitik stärken“, meint Molina. „Der Beirat kann schwarz auf weiß belegen: das sind die Themen bei uns in der Anlage, und darauf brauchen wir eine Antwort.“
Doch auch die BewohnerInnen selbst zogen Nutzen aus der Umfrage. „Wer heute im sozialen Wohnbau lebt, bekommt rasch das Gefühl des Anerkennungsdefizits“, analysiert Molina. „Die Öffentlichkeit ist schnell mit stigmatisierenden Zuschreibungen gegenüber dem Gemeindebau.“ Nicht zuletzt deshalb waren viele BewohnerInnen des Olof-Palme-Hofs hoch erfreut und fühlten sich zum Teil sogar geschmeichelt angesichts der Tatsache, dass Studierende persönlichen Kontakt und einen offenen, kooperativen Zugang zu ihnen pflegten – „nur“ um herauszufinden, was ihnen am Leben im Gemeindebau gefällt und was nicht. „Viele waren wirklich verwundert, dass es so etwas gibt“, erinnert sich Molina.
Wie spiegele ich das, was ich mache, in verständlicher Form an die Beforschten zurück?
Und die Studierenden? „Viele waren das allererste Mal im Feld“, erzählt Molina, „und dann hatten sie gleich mit ihren Forschungsobjekten zusammenzuarbeiten. Die Frage war also: Wie spiegele ich das, was ich mache, in verständlicher Form an die Beforschten zurück? Da war dieses Projekt schon deutlich näher an der sozialen Realität, als man das normalerweise lernt.“ Außerdem bot das Projekt den Studierenden die Möglichkeit, sich mit einem Milieu auseinanderzusetzen, das die wenigsten kennen. „Wenn man die Feldarbeit ernst nimmt, kommt man in Kontexte, die man nicht kennt, und kann dort viel lernen. Da haben sich schon sehr interessante Konstellationen ergeben“, erläutert Molina. „Das große Mitteilungsbedürfnis einzelner Personen, das jedes Zeitmanagement sprengt; die Kommunikationsprobleme mit ausländischen Familien, bis die Tochter von der Arbeit nach Hause kommt und übersetzt; aber eben auch die Begegnung mit der alten, alleinstehenden Frau, die in ihrer kalten Wohnung sitzt, weil sie sich die Heizkosten nicht leisten kann.“
Gerade in solchen Situationen war es wichtig, die Grenzen sozialwissenschaftlichen Forschens und Engagements zu verdeutlichen, betont Molina. Man müsse unterscheiden zwischen Sozialwissenschaft und Gemeinwesenarbeit. In Reflexionsrunden wurden die Erfahrungen, die die Zweierteams bei ihren Befragungen machten, besprochen, außerdem wurden umfangreiche Gesprächsprotokolle angefertigt.
Etwa ein Drittel der Hausparteien nahm letztlich an der Befragung teil, eine im sozialwissenschaftlichen Durchschnitt außerordentlich hohe Beteiligungsquote.
Je länger du hier wohnst, desto besser sind die Beziehungen zu deinen Nachbarn, und je länger du hier wohnst, desto schlechter bewertest du das Zusammenleben in der Anlage.
„Wir haben großen Wert darauf gelegt, nicht die Erwartung zu wecken, dass sich aufgrund der Befragung binnen kurzem etwas ändert“, erklärt Molina. Die BewohnerInnen wurden mittels Postwurfsendung vorab darauf hingewiesen, dass in den kommenden Wochen Teams der Universität Wien in der Anlage unterwegs sein würden, um Interviews für ein Forschungsprojekt zu führen. „Dadurch konnten wir die Erwartungshaltungen ganz gut kontrollieren.“
Überhaupt habe sich die Frage gar nicht in der antizipierten Dimension gestellt, sagt Molina. „Schwierig war es vielmehr, die Desillusionierten dazu zu bringen, an der Befragung teilzunehmen. Die stehen auf dem Standpunkt: ‚Jo eh, hamma schon g’habt, ändert sich ja eh nix, bringt ja alles nix.‘ Die motivierten Bewohnerinnen und Bewohner hingegen nutzten vielfach die Gelegenheit, um ihre Zufriedenheit zu artikulieren.“ Aus diesem Grund mahnt Molina auch bei der Interpretation der Umfrageergebnisse ein wenig zur Vorsicht. 90 Prozent der befragten BewohnerInnen wohnen „gern“ oder „sehr gern“ im Olof-Palme-Hof, aber viele Unzufriedene haben vermutlich nicht teilgenommen, weil sie der Ansicht waren, das bringe ohnehin nichts. Unabhängig davon schätzen fast alle BewohnerInnen die Lage des Gemeindebaus: recht weit entfernt von den ganz großen Verkehrsströmen, praktisch in Grünruhelage und seit der Verlängerung der U1 nach Oberlaa eine Viertelstunde von der Innenstadt entfernt.
In der Analyse ließen sich grundsätzlich zwei Kategorien von BewohnerInnen identifizieren, erläutert Molina, nämlich „Leute, die ein Bedürfnis nach Abgrenzung und der Einhaltung von Regeln äußern, und die anderen, die offen sind und andere Leute kennenlernen wollen“. Es gebe überaus intensiven Kontakt zwischen den alteingesessenen BewohnerInnen – nicht zuletzt durch den MieterInnenbeirat –, wohingegen sich die neu Zugezogenen diese Kontakte wünschen würden und daher die „Anonymität“ beklagen. Am erstaunlichsten war für Molina aber der folgende Befund: „Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der Dauer des Wohnens und der Bewertung des Zusammenlebens und ein ebenso linearer Zusammenhang zwischen der Dauer des Wohnens und dem Verhältnis zu den unmittelbaren Nachbarn, also: Je länger du hier wohnst, desto besser sind die Beziehungen zu deinen Nachbarn, und je länger du hier wohnst, desto schlechter bewertest du das Zusammenleben in der Anlage. Das passiert gleichzeitig.“
Die Faktoren „Generationsunterschiede“ und „Vorbehalte gegenüber MigrantInnen“ können diese Bruchlinien nicht hinreichend erklären, meint Molina. Vielmehr zeige sich hier die schleichende Delegitimation des sozialen Wohnbaus. Der Olof-Palme-Hof wurde in den 1970er Jahren nach neuesten architektonischen Erkenntnissen gebaut, er war ein Gemeindebau für die „besseren Leut’“ mit vergleichsweise hoher AkademikerInnendichte. Diese Leute, argumentiert Molina, hatten ein völlig anderes Selbstverständnis als die ZuzüglerInnen der letzten Jahre mit einer steigenden Anzahl an ArbeiterInnen und Zuwandererfamilien. Heute werden die sozialen Unterschiede auch im Olof-Palme-Hof immer deutlicher sichtbar, und ganz allgemein sei der Gemeindebau heute kein Zeichen sozialdemokratischen Selbstbewusstseins mehr, sondern übernehme immer stärker soziale Versorgungsfunktionen: „Dort ziehen viele hin, die sich woanders keine Wohnung mehr leisten können, und dadurch differenzieren sich die BewohnerInnen nach und nach aus. Als sozial eh schon benachteiligte Person wirst du dich hüten, allzu freche Ansprüche zu stellen“, erklärt Molina. „Dann sagen die Alteingesessenen: Alles wird schlechter, und das liegt an den neuen BewohnerInnen, die neuen BewohnerInnen hingegen sind durchschnittlich zufriedener mit ihrer Wohnsituation – außer dass sie nicht viele Leute kennen –, wissen aber nicht, dass sie die hohe Wohnqualität zu einem nicht geringen Teil den alteingesessenen MieterInnen verdanken.“
Das Forschungsteam um Petra Herczeg und Camilo Molina hat keine schriftlichen Handlungsempfehlungen verfasst, aber im Anschluss an das Projekt viele Diskussionen mit dem MieterInnenbeirat geführt. „Man würde es sich ja auch zu einfach machen, die Probleme auf ‚fehlende Kommunikation‘ zu schieben. Die Leute reden ja eh miteinander“, meint Molina. Die MieterInnenbeiräte können eine enorm wichtige Rolle einnehmen, doch sie werden nur lebendig, wenn es eine gemeinsame Aufgabe, gemeinsame Interessen gibt, die auf der Mikroebene des Gemeindebaus verändert werden können. Bei Gremien dieser Art besteht allerdings auch die Gefahr, dass sie zu hermetischen Zirkeln werden. Die Beantwortung der Fragen, wie dies verändert werden und wie man auch neu zugezogene BewohnerInnen motivieren kann, sich für den Hof zu engagieren, überlassen die SozialwissenschafterInnen der Gemeinwesenarbeit und der Wohnpolitik in Wien. „Aber es ist ja tatsächlich beachtlich“, meint Camilo Molina, „dass der MieterInnenbeirat sich in dieser Form selbst hinterfragt.“ (tg)
Eckdaten zum Projekt
- Titel: Leben, lieben, leiden im Olof-Palme-Hof. Eine BewohnerInnenbefragung in einer Wiener Großwohnsiedlung
- Laufzeit: 12/2018 – 11/2019
- Beteiligte: Petra Herczeg, Camilo Molina, TeilnehmerInnen des Forschungspraktikums
- Institut: Institut für Publizistik- und Komminikationswissenschaft, Institut für Soziologie
- Finanzierung: Institutsbudget Soziologie zur Unterstützung wissenschaftlicher Vorhaben (Datenauswertung, redaktionelle Arbeit für die Beilage zur Mieterzeitung)

